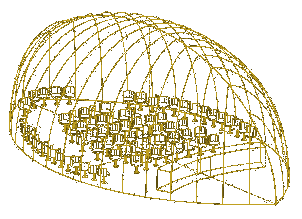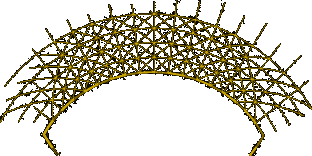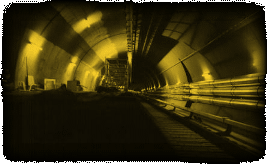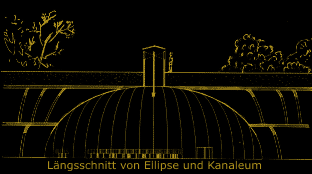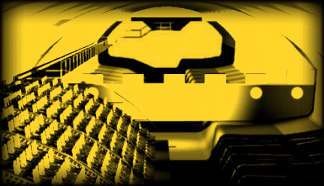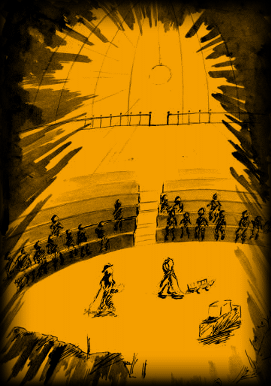E-CENTER WIEN
Um der Übersättigung des Zeitgeistes und auch dem „Kenn-ich-schon“ Effekt der Besucher entgegenzuwirken, sollten sich Information und Show/ bzw. Darbietung inhaltlich immer wieder neu gestalten und verändern können. Die technische und bauliche Ausführung sollte diese Möglichkeiten miteinbeziehen. Nur so kann gewährleistet werden, dass eine gewisse zeitlose Vielseitigkeit vorhanden ist.
So ist gedacht, das E-Center in einem fixen und einem offenen Bereich zu realisieren:
| Bereich 1: | Ein Showteil, bestehend aus dem Kanaleum und dem Mittelraum, ausgeführt mit neuester Technik in ungewohnter Architektur, bestens geeignet für wirkungsvolle Effekte und das Staunen der Besucher, wobei auf spielerische Weise Information vermittelt wird.
|
| Bereich 2: |
Eine Bühne, die sich innerhalb der Gewölbe der Wienflußkubatur befindet und keinerlei technischen Überfluß beinhaltet.
Dieser Gegensatz zwischen Alt und Neu soll nicht nur in Architektur, Umgebung und Ausführung vermittelt werden, sondern auch im Geschehen.
Teil 1 wird von der Technik regiert, Teil 2 vom Menschen: Zwischen den Steinquadern wird dort Theater gespielt- allerdings ohne die gegenwärtige Bühnentechnik und etwaige Lautsprecheranlagen. Die bestehende Akustik muß genügen- wie wohl in alten römischen Amphietheatern- so wie es seit tausenden von Jahren getan wird.
|
Erläuterungen zu Bereich 1:
Der angegebene Show- und Zusatzteil werden in diesem Falle miteinander verschmolzen, sind eher überlappend. Dadurch soll der Überlegung Rechnung getragen werden, dass die Show nur einmal läuft, dann hat man sie gesehen. In diesem Falle wird eher angestrebt, dass auch die Show aus ineinander übergehenden Animationen besteht, die keiner fixen Reihenfolge untergeordnet werden und den Eindruck hinterlassen, man sieht jedes Mal doch noch immer wieder neue Sequenzen, alles wirkt fesselnd auf den Betrachter.
Von der Idee des elliptischen Raumes her, soll im Vergleich dazu auf das Kunsthaus in Graz verwiesen werden: Man befindet sich zwar innen, doch die Ablaufe und Reihenfolge unterliegen dem Besucher, nicht nur optisch wirkt es wie eine Große Zelle, die in viele Unter- und Nebenzellen unterteilt ist. Eine ähnliche Wirkung soll in diesem Beitrag erreicht werden.
Die Nutzung des Bereiches 1 würde sich normalen Öffnungszeiten und Sonderterminen unterwerfen. Dazu gäbe es auch die Möglichkeit den Mittel-Raum zugunsten spezieller Seminare zu nutzen oder wissenschaftliche Neuerungen im Bereich der Abwasserentsorgung oder ähnlich verwandter Themen zu präsentieren.
Darüber hinaus könnte man auch ein spielerisches Schüler-Seminar gestalten, um die richtige Abfallbeseitigung etc. auf spielerische Weise näher zu bringen, mit anschließend auszufüllendem Gewinnkupon bei richtigen Antworten.
Während der üblichen Öffnungszeiten findet z.B. stündlich für Gruppen ein Abstecher zum Hauptsammelkanal statt. Die Bühne im Wienflusstunnel ist außerhalb der Spielzeiten nur unter Aufsicht begehbar.
Daß es einen Vorraum mit Garderobe, WC und den speziellen Souvenirshop gibt, ist selbstverständlich.
Erläuterungen zu Bereich 2:
Der in den Unterlagen angesprochene Zusatzteil würde eine andere Bedeutung bekommen:
Eine Theaterbühne, gedacht für in- und ausländische Produktionen, ob nun für spezielle Stücke in Bezug auf Wasser/ Bewegung/ Unterwelt oder andere Projekte. Dort könnte der Begriff „Untergrundkunst“ die junge Theater-Szene animieren- und zwar nicht nur in Wien.
Durch die Transparenz zwischen Theater, Spiel und Tatsächlichem sorgt man, dem E-Center nicht nur den Ruf einer fixen Anlage zuzuschreiben, sondern beweist ständige Flexibilität und kann Kontakte und Austausch in alle Welt aufbauen. Ob Wanderausstellungen von unterirdischen Fotoserien anderer Städte (die wären im Bereich des „Kanaleums“ unterzubringen, das dafür eigene Bereiche freihalten müsste) oder Künstleraustausch ganzer Produktionen sei dahingestellt. Es würde in einer eigenen Weise auch ständig Material für die Bereiche lebendige Kunst und Medien liefern. Ein Ort, der auf kultureller Ebene internationale Kontakte fördert und ebensolche Projekte nicht nur zulässt, sondern sie auch unterstützt.
Darüber würde die Mitverwendung des Wienflusstunnels durch einen langen begehbaren Gang, dessen Wirkung nur schmälern. Lediglich die Nutzung im mittleren Bereich, ohne überflüssige technische Einrichtung und in einfacher Gestaltung, würde diesem Areal Rechnung tragen.
So erscheint der Gedanke eines unterirdischen Theaters inmitten der Stadt Wien, schräg unter der Oper als touristisch sehr interessantes und attraktives Modell, dass ebenso für Aufmerksamkeit sorgen wird.
Die Nutzung des Bereiches 2 wäre nicht nur für offiziell terminlich angekündigte in- und ausländische Aufführungen von Interesse, sondern ebenso für Schüleraufführungen, ein eigens gegründetes Gehörlosen-, Blinden- oder Behindertentheater (um Minderheiten Möglichkeiten des eigenenkünstlerischen Ausdruckes zu vermitteln, die sie selten erhalten und auch deren Wertschätzung in der Gesellschaft zu erhöhen), Trommelsessions, Under-Clubbings, etc.
Die Ellipse - Das Zentrum
Um gewohnte Klischees zu umgehen, sollte von vornherein von der rechteckigen Raumarchitektur abgegangen werden. Ein Erlebnisort, der „schachtelweise“ aufgebaut ist, nimmt sich selbst an Wirkung. Der zentrale Mittelpunkt als Ort der optischen und akustischen Signale, die als sich überlappende Projektionsflächen an den Wänden wandern und Information und zugleich Staunen hervorrufen, besteht aus einem elliptischen Raum. Soweit technisch möglich, könnte die optische Wirkung des IMAX (siehe auch neben techn. Museum Wien) angestrebt werden.
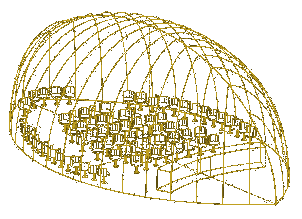
Das Zentrum
Die Außenwand bietet teilweise Einblick vom Labyrinth rundherum, ist aber auch zugleich Projektionswand von wandernden Bildern und Videosequenzen, die sich auch überlappen oder ineinander verschmelzen und wieder auflösen. Durch entsprechende Computerprogramme, die auch dazu beitragen, dass nicht der Effekt eines sich ständig wiederholendes Videobandes abläuft. Drehbare, bequeme Sitze und geschickte, räumliche Akustik, die den Betrachter mit in den Bann zieht. Aufeinanderfolgende Ausschnitte von Information, Wissen und bewegten Bildern um Wasser, Unterwelt und Bewegung wechseln sich ständig ab. (Siehe auch Kanalmuseum in Paris/ Videoshow)
Das Kanaleum
Ein Labyrinth, in dem man sich weder orientieren noch verirren kann
Der bereits vor Jahren von der MA30 geprägte Namen Kanaleum erscheint hier angebracht zu sein.
Rundherum um diesen abgeschnittenen Ellipsoid Gänge und Ausstellungsräume auf zwei Geschossen. Das Kanaleum, beinhaltet Vitrinen mit Ausstellungsgegenständen, Modellen und technischen Apparaturen, dazwischen Bildschirmflächen an den Wänden, die durch Bewegungsmelder aktiviert werden. Alles in einem Labyrinth, das immer wieder anhand von Glaswänden Einblick in die große Ellipse bietet. Der Verlauf der Gänge untergräbt unsere Vorstellungs- und Orientierungsmöglichkeiten- es gibt keine rechten Winkel, die Abzweigwinkel ändern sich schier unregelmäßig- für die Raumvorstellung unseres Geistes ein unlösbares Problem. Allerdings sind sämtliche Wände vom Zentrum der Ellipse nach außen leicht gewölbt, was im Unterbewusstsein sofort registriert wird.
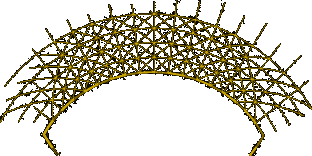
Die Geometrie der Wände richtet sich nach einem speziellen Raster: Zu den Schnittpunkten zwischen parallelen Ringen um die Ellipse und den strahlenförmig nach außen gerichteten Linien, die an den Stahlstreben beginnen, werden die Diagonalen gezogen. In der Fortsetzung zum nächsten Schnittpunkt usw. ergeben sich gekrümmte Linien.
Die Gänge sind nur schwach beleuchtet, allerdings nicht von der Decke, sondern durch einen etwa 20cm breiten Kanal entlang der Gangmitte, der in tiefblauem Licht die dunklen Wände erhellt. An den Kanten und Ecken phosphoriszierende Streifen, die das sogenannte Schwarzlicht hell zurückwerfen. Der kleine Wasserstrang bietet nicht nur Licht, sondern kleine rote Bälle zeigen durch die Strömung den richtigen Weg an. Um das ganze Labyrinth ein Rundgang, der eigens beleuchtet ist, als Fluchtweg dient, und von jeder Stelle ohne Probleme aufgesucht werden kann. Zwischen den Gängen, Abzweigungen und Nischen, immer wieder Bildschirme und Vitrinen, die sich durch ihre eigene Helligkeit und Farbe entsprechend abheben.

Das Labyrinth des Kanaleums |
Die Rattenkammer
In einem eigenen kleinen Raum inmitten des Kanaleums die sogenannte Rattenkammer- ein Ort, der von verschiedenen Seiten des Labyrinthes einsehbar ist, teils sogar in die Gangwände involviert ist. Dazu eine Grafik in Form eines der Infobildschirme, die sich per Bewegungsmelder einschalten oder mittels einer Projektionsfläche an der Innen-Rückwand, in dem zu lesen ist, das es weltweit Städte gibt, bei denen man von bis zu sechs Ratten / Einwohner ausgehen muß. Dass es in Wien nur 1-2 R./ Kopf sind, aufgrund der hygienischen Verhältnisse und nicht zuletzt ein kleiner Abstecher informeller Natur über Ratten und deren ausgesprochene Intelligenz, ihr Sozialverhalten untereinander, etc. (Siehe auch DUNGEON in London, wo es einen ähnlichen Raum gibt, der allerdings nicht der Information dient, sondern lediglich um dem Eindruck des Gruselns zu unterstützen, der entsprechend gestaltet ist und von unzähligen Ratten belebt wird.) |
Bunkerraum
Ebenso sollte man sich der Geschichte entsinnen, welch weitere Bedeutung die Unterwelt für große Menschenmengen haben konnte. Im historischen Teil sollte es einen authentischen Bunkerraum geben, der auch darüber informiert (Siehe auch Berliner Unterwelten e.V., Bunkermuseum/ Emden in Ostfriesland, Foltermuseum/ Wien)
Ausstellungsraum
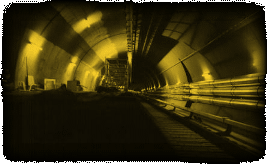
Für Sonderausstellungen anderer Städte, über unterirdische Anlagen, Höhlen, unterird, Wasserwege, etc. sollte ein eigener Raum bereitgehalten werden. Auch dadurch wird sehr zur Werbung beigetragen, denn auch wer schon mal da war, kommt gerne wieder wenn er von neuen Attraktionen hört.
Städtevergleich
Zuletzt sollte es auch Hinweise und Vergleiche zu anderen Großstädten geben in Bezug auf Einwohner, Kanalisation (ab wann?), techn. Stand, U.-Bahnbau, Bildgalerie, etc. (Siehe auch „New York Underground- Dark Passenge v. Julia Solis, C.Links-Verlag, Berlin)
Das Hochwassermodell
Anhand eines Modells mit dem Stadtzentrum und dem Wienfluß bis über die Stadtgrenze hinaus, mit dem bereits fertigen Hauptsammelkanal, läßt sich auf beeindruckende Weise demonstrieren, welche Folgen die Niederschläge auf die Flüsse und das gesamte Kanalsystem haben können. So lassen sich beliebige Niederschlagsmengen auf einer Computergrafik mit verschiebbaren Wolken unterschiedlicher Größe und Zeitdauer einstellen, die dann mit dem Startbutton auf dem Modell tatsächlich simuliert werden.
Dazu auch die Information, dass ein Jahrtausendhochwasser, das alle bisher getroffenen Sicherheitsvorkehrungen der Stadt übertreffen würde, dazu führen könnte, das die U4 durch den Wienfluß überschwemmt werden würde und bei der Station Schwedenplatz das Wasser über die Rolltreppen in die U1-Linie laufen könnte. Auch dieses Szenario sollte spielbar sein- denn für Schulklassen und Kinder sicherlich ein Aspekt, der die Gewalt des Wassers als bleibende Erinnerung veranschaulicht.
Auf Knopfdruck von markierten Jahreszahlen erscheinen Videoanimationen von damaligen Hochwasserkatastrophen und der Ausuferung des Wienflusses. Ob zur Zeit der Überflutung von Schönbrunn, durch den großen Eisstoß auf der Donau oder anderen bekannten Katastrophen, sollte auch die noch sehr geringe Bebauungsdichte dargestellt sein.
Das Kaleidoskop
Im Sinne einer ständigen Werbung und zugleich auch um die Neugierde zu wecken gibt es über der Kuppelmitte eine Art Teleskop, dass allerdings den Blick in die entgegengesetzte Richtung freigibt: Passanten und Spaziergänger können sich jederzeit anhand kleiner Bildschirme von dem ständigen Treiben im Inneren des Kanaleums und des E-Centers überzeugen.
In einer Art Säule sind in unterschiedlicher Höhe (für groß und klein) rundherum an die zwölf Bildschirme verteilt, die wechselnde Perspektiven oder Situationen vom Innenleben zeigen- Allerdings immer wieder durch Programme verzerrt, gespiegelt, gewölbt oder wandernd- so dass keine tatsächliche optische Information daraus zu ermitteln ist, sondern die Phantasie und Neugier geweckt wird.
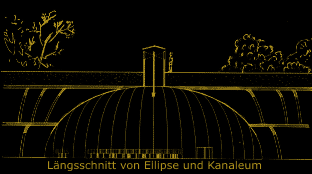
So können beispielsweise einige Ausschnitte eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, indem es wandernde Kameras gibt, die an einer Schiene entlang der Innenseite der Ellipse fahren und mittels eines Kugelgelenkes von dort die räumlichen Perspektiven entlang der Wand bis in den Raum hinein projizieren.
In der Mitte der Ellipse zentrisch eine weitere Kamera unter der Decke und an den verschiedenen Modellen und Stationen des Kanaleums ebenso.
Nicht nur für die Kleinen wohl besonders interessant die wechselnden Ausschnitte aus der Rattenkammer- und zwar nicht in Gesamtbild des Raum-Modells, sondern inmitten des kleinen Raumes einige Kameras, die in Großaufnahme bewegte Objekte erfassen und fixieren.
Dadurch soll das E-Center nicht erst interessant wirken, wenn man sich drinnen befindet, sondern soll ebenso zufällige Passanten ansprechen und sich seinen Ruf der Einzigartigkeit in allen Bereichen verdienen
Die Postkarten-Maschine
Zwischen den Bildschirmen gibt es mehrere Automaten, die gegen Einwurf eines Euro jeweils eine Postkarte erzeugen- und zwar nicht vorgefertigte Motive, sondern genau von jenem Bild, das man auf dem Bildschirm gerade sieht: Durch Antippen der Bildschirmoberfläche wird dieses auf ein gewähltes Format übertragen und ähnlich einem Passfotoautomaten ausgedruckt.
Interessant für Touristen, Passanten und Solche, die aus Zeitgründen „nur gerade vorbeikommen“, nicht hinein können aber doch zeigen wollen, dass sie dort waren...
BEREICH 2
In diesem Teil wird versucht, mit geringst möglichen Umbauten das Wienflussareal auf optimale Weise zu bereichern. Es gilt die einzigartige Kulisse, die durch kein Theater der Welt derart dargestellt werden könnte, ebenso zu erhalten wie die damit verbundene Handschrift Otto Wagners.
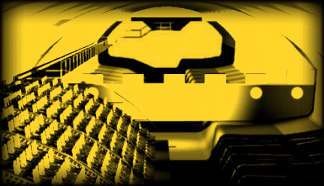
|
Die einzelnen Elemente bestehen aus der Publikumstribüne, der Bühne und den beiden abgrenzenden Kulissenwänden.
Die Publikumstribühne faßt etwa 150 Sitzplätze, verteilt auf mehrere Sektoren und kann bei Hochwassergefahr mittels Seilwinden an die Gewölbedecke geklappt werden. Je nach Besuch und Veranstaltungsart werden die Tribünen herabgesenkt.
|
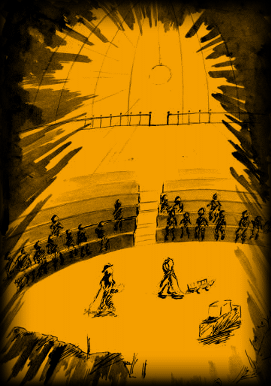
|
Die Bühne
Halb-muschelförmige Ausbuchtung der gegenüberliegenden Tunnelwand ohne übertriebene technische Einrichtungen, sondern nach dem Schema alt-römischer Amphietheater, um die bestehende Akustik zu unterstreichen. Ebener Steinboden 36 x 16 Meter ohne Hebezüge oder andere bewegliche Teile. Fixe Vorrichtungen an der Rückenwand um Bühnenbilder aufzuhängen, Lichtanlagen oder andere leicht bewegliche Gegenstände zu montieren.
|
|
|
Kulissenwände
Optische Abgrenzung des Areals und zugleich Windfang für das Publikum. Bestehend aus einfachen Metallgerüsten, deren Bezug und äußeres Profil je nach Art der Veranstaltung verkleidet werden kann. Bei Bedarf ebenso an die Gewölbedecke klappbar.
|

|
Moderne Kultur

Um ein zeitgerechtes Programm zu bieten, daß nicht nur eine bestimmte Zielgruppe erreicht und mit seiner Art der Präsentation auch "Stammkunden" Neues bieten kann, sollte nicht nur die Gestaltung desselben vielseitig sein. So sollten die unterschiedlichsten Interessensvertretungen zur Teilnahme daran motiviert werden- denn nur durch ständige Eigeninitiativen der Veranstaltenden, Musiker oder Theatergruppen läßt sich das Spannungsfeld von Neugierde und Erwartung aufrechterhalten. So wäre eine Zusammenarbeit zwischen den Kulturabteilungen der Stadt Wien, (z.B. Interessensgemeinschaft freie Theater/ Kontakt mit in- und ausländischen Bühnen, etc.) und privaten Veranstaltern denkbar. Als Attraktion für Touristen und Besucher ebenso wie für Einheimische sollte das Angebot dann von Trommelsessions mit freier Teilnahme und "Under Clubbings" bis zu extravaganten Theateraufführungen oder musikalischen Events der ungewöhnlichen Art reichen. Darüberhinaus soll auch für Jedermann die Möglichkeit bestehen, gute Ideen be
zutragen und diese einer Jury zur Abstimmung vorzulegen- mit entsprechendem Entgelt bei Erfolg. Die "Ideensuche" hätte mit diesem Wettbewerb erst den Anfang gefunden. Kulturelle Entwicklung wird der Bevölkerung "angeboten"- ähnlich einem Schulversuch, der animieren soll.
Sämtliche Darstellungen und Fotos zu den Texten und Beschreibungen, sind lediglich als schematisch anzusehen und entbehren jeglicher statischen Berechnung oder sind fiktiv.